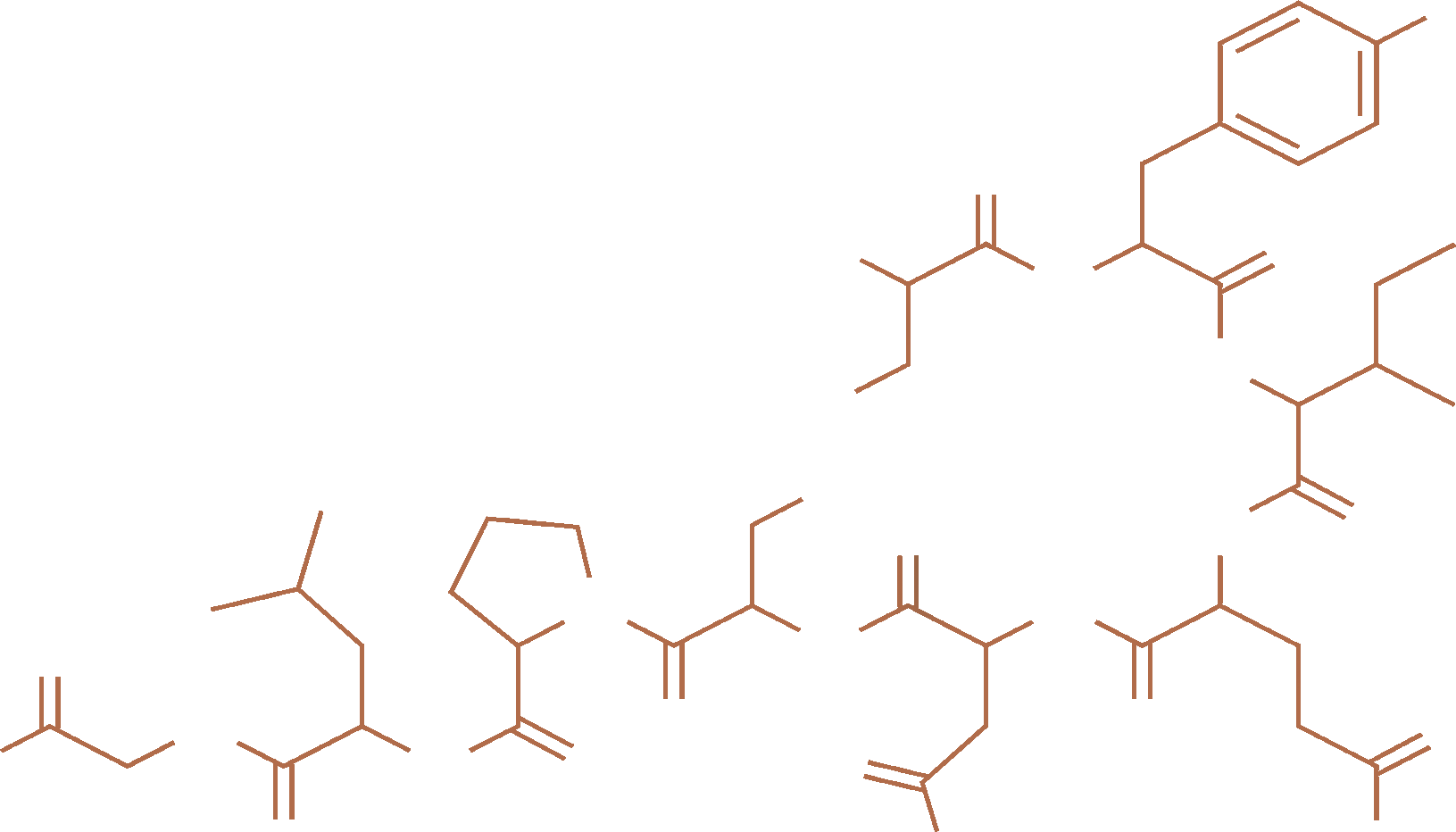Mut zur Menschlichkeit: Authentizität ist mir mittlerweile wichtiger als Perfektion
veröffentlicht von Anika Czipfl
1. Mai 2025
Ich spüre, wie meine Stimme zittert. Mein Körper schwitzt, als stünde ich in den Tropen, obwohl ich in einem wohltemperierten wunderschönem Tagungsraum in München stehe. Mein Herz schlägt schneller, als ich sprechen kann (was bei mir echt was heißt, ich kann sehr schnell sprechen...) und meine vertrauten, jahrelang eingeübten Techniken, die mir sonst Ruhe geben, greifen nicht. Atmen. Erden. Heute gelingt es mir nicht.
Vor mir: hundert erwartungsvolle Gesichter. Ich völlig sichtbar und verletzlich. Ich spüre wie die Angst wächst, dieser Situation nicht gewachsen zu sein. Während ich versuche, die Kontrolle zurückzugewinnen, schießen mir in Sekundenschnelle unzählige Gedanken durch den Kopf, keiner davon besonders freundlich oder hilfreich. Es fällt mir zunehmend schwer, mich zu konzentrieren und meinen roten Faden wiederzufinden.
So fühlte ich mich.
Ein Moment, in dem nicht meine Professionalität auf der Bühne glänzte, sondern meine Menschlichkeit mit all meinen Schattierungen sichtbar war.
Was passiert mit uns, wenn der Schalter zwischen Professionalität und Menschlichkeit plötzlich nicht mehr funktioniert? Braucht es überhaupt einen Schalter?
Darauf gibt es zahlreiche Antworten und jede ist so individuell wie der Mensch selbst.
Ich bin es gewohnt, zwischen Sachlichkeit und Emotionalität souverän zu wechseln. Oft in hochdynamischen Gruppenkonstellationen, in denen ich unter Zeitdruck priorisieren muss, was gerade von größerer Bedeutung ist. In meiner Komfortzone, dort, wo ich mich sicher und zu Hause fühle, gelingt mir dies meistens sehr leicht. In unbekannten Situationen, in denen viele neue Eindrücke auf mich einwirken, wird es zur Herausforderung.
Und so kam es, dass ich an diesem Tag so in meiner Aufregung gefangen war, dass mir der Wechsel nicht gelang. Mit dabei einen Beitrag über Inklusion, welcher aus meinen ureigenen persönlichen Erfahrungen entstanden ist. Ein Beitrag, der mir nicht nur fachlich, sondern auch persönlich sehr am Herzen liegt. Meine Nervosität stand offen im Raum. Ich fühlte mich unsicher, schwach, verletzlich... Alles andere als professionell.
Doch was genau bedeutet eigentlich Professionalität?
Ist es professionell, Gefühle zu verstecken, souverän aufzutreten und Perfektion vorzutäuschen oder ist es gerade die Fähigkeit, eigene Grenzen und Schwächen zu zeigen, welche auch Souveränität beweisen kann?
Gefühlsregulation ist eine zentrale Kernkompetenz für jeden, der mit Menschen arbeitet. Unregulierte Emotionen wie Wut, Angst oder Stress erhöhen das Risiko, dass grenzüberschreitende, beschämende oder entwertende Muster an die Oberfläche treten – verbal oder nonverbal. Professionelles Handeln braucht Abstand zwischen Gefühl und Reaktion. Diese Selbstführung ist nicht nur bedeutend, sie ist aktiver Kinderschutz.
Kinder brauchen emotionale Sicherheit. Sie orientieren sich an der Stabilität der Erwachsenen.
Unsere Aufgabe ist es, einen sicheren Bindungsrahmen mit feinfühligen und verlässlichen Strukturen zu gestalten und das setzt emotionale Selbstregulation voraus. Für mich ist das ein wesentlicher Bestandteil von Professionalität.
Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, Beziehung zu gestalten und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in emotional fordernden Situationen. Wer sich selbst nicht halten kann, kann kein sicherer Hafen für andere sein.
Ist Professionalität also bedeutend? Ich finde ja.
Und diese Bedeutung darf Raum lassen. Raum lassen für Menschlichkeit.
Nach meinem Vortrag kamen viele Menschen auf mich zu, berührt und bewegt.
Einige sagten mir, dass meine sichtbare Unsicherheit ihnen Mut gemacht habe, selbst mutiger zu sein. Sich zu positionieren. Sich zu trauen, auch mit der Gefahr, Fehler zu machen und mit dem Wissen: Niemand ist perfekt.
Zu diesem Zeitpunkt stand mir meine eigene Scham noch im Weg. Ich hatte das Gefühl, nicht perfekt performt zu haben. Ich konnte, noch nicht erkennen, was mir jetzt, mit etwas Abstand und sortierten Emotionen, so deutlich wird:
Durch meine Schwäche wurde sichtbar, was ich in meinen Seminaren mit viel Aufwand und Überzeugung zu vermitteln versuche: Nicht Perfektion macht uns stark, sondern Authentizität und Menschlichkeit.
Natürlich benötigt diese Authentizität einen Rahmen. Für mich darf Wahrhaftigkeit kein Freifahrtschein für jedes Verhalten sein. Sie bedeutet nicht emotionale Enthemmung. Sie erfordert Kontextsensibilität, damit sie nicht zur Belastung für andere wird. Was in privaten Beziehungen als authentisch gilt, kann im professionellen Rahmen unangebracht sein. Grenzwahrende Echtheit braucht Sprache, Reflexion und die Bereitschaft, sich mit den eigenen Schwächen vertraut zu machen und diese anzunehmen. Letzteres fällt mir noch schwer. In Situationen, die nicht so rund laufen wie geplant, spüre ich die Einladung zur Selbstannahme besonders deutlich. Und gleichzeitig öffnet genau dieser Raum, in dem man nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen teilt, eine neue Möglichkeit:
Wir werden berührbar und damit auch fähig, zu berühren.
Wenn wir unsere eigene Unvollkommenheit anerkennen, können wir mitfühlender sein: mit uns selbst und mit anderen. Mein wohl persönlichster Satz in diesem Text: Schwächen gehören nicht hinter eine perfekte Fassade, sie gehören ins Licht.
Denn dort, wo auch wir in unserem Sein gesehen werden, sind wir echt.
Ein Wegabschnitt, auf dem ich gerade selbst viele neue Erfahrungen sammle.
Ich habe an diesem Tag nicht perfekt funktioniert.
Aber ich bin geblieben, mit allem, was in mir war.
Vielleicht ist es das, was wir in der Pädagogik, in der Inklusion, im Leben mehr brauchen: keine perfekten Auftritte, kein methodisches Vorgehen nach theoretischen Lehrbüchern, sondern echte Begegnung.
Abschließend möchte ich schreiben: Menschlichkeit beginnt für mich dort, wo wir unseren eigenen Mut nutzen, uns mit allem zu zeigen, auch mit den Seiten, die nicht glänzen. Dies ist für mich kein Widerspruch zur Professionalität, sondern der Boden, auf dem Wunderbares wachsen kann.
Menschlichkeit zu leben, braucht keine Maske der Unverwundbarkeit, sondern den Mut, mit ganzem Herzen sichtbar zu sein. Ich habe mich gezeigt. Ich hatte Angst und war unsicher. Ich habe mich nicht stark gefühlt. Es war wackelig. Es war anders als geplant. Die Verbindung mit Menschen hat mir geholfen, zurückzufinden ins Vertrauen und in meine Kraft.
Ich weiß nun: Schwäche ist kein Grund für Scham.
Sie ist ein stiller Beweis fürs Fühlen und dafür, dass ich Mensch bin.
Genau darin liegt mein Warum. Ich spüre, wie viel Sinn darin liegt, mit Herz dabei zu sein, nicht perfekt und dennoch voller Hingabe. Mit Verantwortung, Mut und Herzenswärme. Mit Begeisterung seinen eigenen Weg gehen, selbst wenn dieser nicht immer gerade ist. Fest daran glaubend, dass es sich lohnt, für das, was man liebt, sichtbar zu werden, auch wenn das Herz dabei zittert.
Musik "Acoustic Guitar 1 by Audionautix" lizensiert über MagixVideoDeluxe
München - Symposium am 30. April 2025: Dr. Anke Elisabeth Ballmann lud ein den Tag der gewaltfreien Kindheit im Sinne des Kinderschutzes zu verbringen. Neben Pfarrer Rainer Maria Schießler (Begrüßund und einleitende Worte), Anke Ballmann (Haltungen und Handlungen), Claudija Stolz (Traumfolgekompetenzen), Romy Stangl (häusliche Gewalt), Judith Pieroth-Neef (Gewalt und Gesundheit) durfte ich zum Thema Inklusion meine Erfahrungen aus der Praxis mit allen Besucher:innen teilen. Frau Marlis Peschke von Tiny Art Oasis präsentierte ein wunderschönes Kunstwerk, welches versteigert wird und dessen Erlös der Stiftung zu Gute kommt. Am Ende der Veranstaltung trafen sich alle Referierenden auf der Bühne zu einem abschließendes Austausch. Ich bin sehr dankbar für diesen aufregenden und sehr bereichernden Tag.